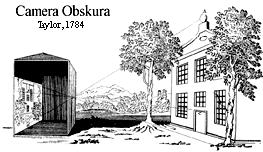
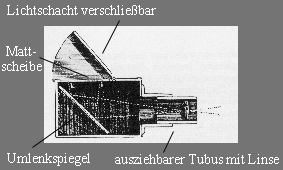
und Entwicklung von Variationsmöglichkeiten der Kamera Claudia Pfeffer, Seminar 1998/2000 Eine Unterrichtssequenz für die 7. Jahrgangstufe
|
| Zum Themenbereich des Lehrplans: 7.3 Gestaltete Umwelt: Erfinden,
Konstruieren, Nachbilden
Teil I: ca. 8 Doppelstunden Teil II: 3 Doppelstunden |
| Die historische Abbildung zeigt die Funktion und den Gebrauch der Camera obskura. Das in der Kamera entstehende Lichtbild läßt sich nachzeichnen. Das ist nicht so ganz einfach wie es aussieht, denn das Lichtbild ist selbst bei viel Sonne außen recht schwach, und ein schlechter Zeichner wird hier auch nur zu schlechten Ergebnissen kommen. Von Canaletto (18.Jh) wird gesagt, daß zahlreiche seiner Städteansichten mit Hilfe einer zeltartigen, mobilden C.O. entstanden. | 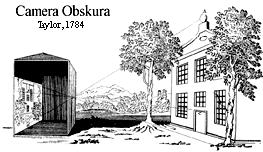 |
| Der Querschnitt durch diese historische C.O.(um 1900) zeigt deutliche Verbesserungen auf. Mit Hilfe einer Linse und eines ausziehbaren Tubus läßt sich die Kamera deutlich verkleinern. Ein Spiegel kehrt das Bild um und wirft es auf eine Mattscheibe, auf der man es nachzeichnen kann. Der Lichtschacht reicht in der Regel nicht aus um das Tageslicht auszuschließen. In diesem Fall stülpt sich der Zeichner ein schwarzes Tuch über den Kopf und die Kamera. | 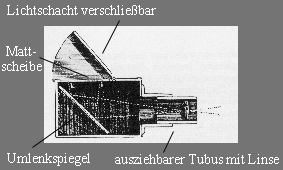 |
| Die Aufnahmeöffnung wird mit einer Stecknadel in Alufolie gestochen,
wobei darauf geachtet werden muß, daß die Öffnung annähernd
rund ist und ohne Brauen. Der Durchmesser, 0,35 mm, wird an einem Lineal
abgeschätzt. Den meisten Schülern gelingt das mühelos.
Mit Hilfe einer halbfertigen Lochkamera wird nun erklärt, wie Teil D in die Kamera eingesetzt wird. Hier entstehen leicht Fehler, wenn nicht gezeigt wird, daß Teil D mit dem Ausschnitt nach hinten eingeklebt werden muß. Dabei bleibt ein Freiraum von ungefähr einem Zentimeter, um die Kasette mit dem Negativ einzuschieben. Die Kassette muß sich mühelos in die Kamera schieben lassen, sonst entstehen beim Filmwechsel in der Dunkelkammer Probleme. Dann werden Teil F und G zusammengesetzt und auf Teil E, vorne an der Kamera befestigt. Haben die Schüler bisher nicht genau genug gearbeitet, so gibt es spätestens jetzt Probleme, weil der Deckel der Kamera, Teil F/G, zu eng ist. Ist die Kamera zusammengeklebt, so werden die geklebten Kanten mit schwarzen Tonpapierstreifen überzogen, damit sie auch sicher lichtdicht sind. Anschließend wird nach auf den Plänen bei Olpe angegebenen Maßen die Planfilmkassette hergestellt. Nun folgt eine theoretischer Abschnitt: Die Schüler lernen die Fachbegriffe "Negativ" und "Positiv" kennen, sie erfahren, daß der Film wegen seiner lichtempfindlichen Schicht nur in absoluter Dunkelheit in die Kamera eingelegt und herausgenommen werden kann. Zudem muß erläutert werden, wie der Film in die Kassette eingeschoben wird: der Planfilm, der nur auf einer Seite beschichtet ist, hat eine Markierung, die sich im rechten unteren Eck befindet. Laden und Belichten des Films
Bau der zylinderförmigen
Kameras
|
| Netzadressen:
Geben Sie in der Suchmaschine Altavista den Suchbegriff Lochkamera ein und Sie können sich nicht mehr retten vor Informationen zum Thema Lochkamera! http://brightbytes.com/cosite/sanfran.html
|